
Aline – von Luise Rind
Aline oder das Ende des Sommers
Augen von Luise Rind, die in Köln lebt. Der Text ist im Online-Kurs Literarisches Schreiben entstanden und ein Auszug aus einer längeren Geschichte
Augen
Wir saßen um den runden Gartentisch herum, niemand saß jemandem gegenüber. Zu dritt an einem runden Tisch gab es kein Gegenüber. Jeder starrte ins Leere. Meine Mutter drehte den Kopf zur Seite und blickte auf das benachbarte Backsteinhaus. Ich spürte, dass sie das Schweigen brechen, irgendetwas sagen wollte, dass sie mit den Augen absuchte, welcher Eindruck aus der Umgebung zu Worten geformt werden konnte, welches Geräusch, welche Erkenntnis einen Kommentar verdiente. Nichts war es wert. Nichts war die Anstrengung wert, zu sprechen und nichts von alledem, was gesagt werden konnte, ergab Sinn.
Stumm richtete Mariam ihre glasigen Augen wieder auf die beige Tischdecke, deren lange Fransen sie mit den Fingern zu Zöpfen flocht. Ich fand mich in diesen hellblauen Augen nicht wieder, sah mich selbst nicht gespiegelt, wenn ich hineinblickte. Meine eigenen Augen sind so dunkel, dass sich die Farbe kaum von der Pupille absetzt, ich habe nicht die Augen meiner Mutter geerbt, sondern die meines Vaters. Ein angenehm kühler Windstoß durchbrach das unsichtbare, vertraute Schweigen und ließ die Tischdecke kurzzeitig tanzen. Mein Vater nahm das natürliche Zeichen zum Anlass, mit einem Nicken in unsere Richtung aufzustehen. Jetzt müsse er aber wirklich mal weitermachen.
Womit, fragte ich mich. »Okay«, sagte ich laut und versuchte, zu lächeln. Statt wie erwartet ins Haus, ging Jakob in die hinterste Ecke des Gartens, in der ein winziger Schuppen stand, eher ein Schüppchen, eine überdachte, halboffene Kiste. Die zusammengenagelten Holzplanken waren hellbraun gewesen, als er den Schuppen vor zwei Jahrzehnten gebaut hatte, jetzt waren sie dunkelgrau, morsch und rissig. Wie viele Splitter ich mir als Kind beim Verstecken dahinter zugezogen hatte. Während des Wartens auf Jaron, der mich immerzu hatte suchen müssen, Verstecken war mein Lieblingsspiel gewesen, und um meine Aufregung, die mich hätte verraten können, zu unterdrücken, hatte ich immer an dem Holz herumgeknibbelt, hatte mit meinen Fingernägeln in den Rissen und Löchern gepult, bis es weh getan hatte. Augen
Intuitiv blickte ich auf meine Hände. Um beschäftigt zu sein, hatte ich gestern zuerst meiner Mutter und dann mir selbst die Fingernägel lackiert. Jetzt bereute ich es. Die bereits abgeblätterte rote Farbe an den Nagelspitzen erinnerte mich mahnend daran, dass ich wieder anfing, an den Nägeln zu kauen. Vielleicht ein Ersatz für das Pulen im Holz. Für das Warten auf meinen Bruder, ein Warten, das dieses Mal endlos sein würde. Ich hatte gedacht, dass es jeden Tag etwas einfacher werden würde. Seit der Beerdigung waren achtundzwanzig Tage vergangen, seit seinem Tod fünfunddreißig. Es wurde nicht einfacher, es wurde nicht einmal anders. Jeder Tag fühlte sich gleich an, gleich sinnlos und gleich leer.
»Der Garten wuchert zu«, durchbrach Mariam abrupt meine Gedanken. »Das alles«, sie deutete mit dem Kopf auf den Efeu, der sich seinen eigenen Weg am Zaun entlang in alle Ecken bahnte und die knochigen Rosenstöcke einzunehmen schien, »das sieht furchtbar aus. Und es ist mir egal.« Ihre Stimme wurde leiser, brüchig. »Das kann doch nicht sein.« Augen
Ich blickte auf den mattgrünen Efeu. Ich mochte das Unbändige, das Unkontrollierte, konnte mit in Form geschnittenen Buchsbäumen und Vorgärten mit zur Haustüre führenden weißen Kieswegen nicht das Geringste anfangen, weil es der Natur vollkommen widersprach. Gleichzeitig wusste ich, wie gut meiner Mutter die Gartenarbeit tat, die körperliche Anstrengung, die frische Luft, die Düfte, die von Blumen, Blüten, Wurzeln, Holz aufkamen, und die sich in Kleidung und Haare setzten. Welche Wichtigkeit die schmutzigen Knie und Hände, die mit der Bürste geschrubbt werden mussten, damit die Dreckklumpen verschwinden und im braun gefärbten Wasser in Richtung Abfluss schwimmen würden, für sie hatten, weil sie Zeichen und Zeugen des Getanen waren. Wie zufrieden Mariam wirkte, wenn sie abends mit einem Glas Wein in der Hand auf der Terrasse stand und im letzten Licht den Unterschied zu vorher erkannte, den sie mit ihren eigenen Händen geschaffen hatte.
»Ich will gar nicht daran denken, wie es im Cux im Garten aussehen muss«. Cux, das war das Ferienhaus, das meine Mutter von ihrer Großmutter geerbt hatte. Weil es in der Nähe von Cuxhaven stand, wurde es irgendwann das Cux getauft, das Cux in Cux. Ich strich über die Tischdecke. »Eva schaut doch bestimmt ab und zu nach.« Eva und Mariam waren beste Freundinnen gewesen, früher, als Mariam ganze Sommer in Cuxhaven bei den Großeltern verbracht hatte.
Meine Mutter schnalzte mit der Zunge. »Eva hat eine Beileidskarte geschrieben. Sie hat ihn aufwachsen sehen und nicht einmal mehr angerufen. Als ob sie noch nach dem Haus guckt.« Vehement schüttelte sie den Kopf.
Zum ersten Mal seit langer Zeit dachte ich wieder bewusst an das Haus. Es musste vier Jahre her sein, dass ich in Cuxhaven war. Ich hatte meine Urlaube anders verbracht. Nicht mehr mit den Eltern, nicht mehr an der deutschen Nordseeküste. In Vietnam zuerst, dann Mittelamerika und immer wieder in Rom. An der Stadt sah ich mich nicht satt. Zuletzt war ich mit Jaron drei Tage lang dort gewesen, hatte ihm begeistert meine Lieblingscafés und die beste Pizza der Stadt gezeigt, die wir verbotenerweise auf der Spanischen Treppe gegessen hatten. Den Flecken des Olivenöls auf meinem bunten Blumenkleid bekam ich bis heute nicht herausgewaschen.
In der abgekühlten Frühlingssonne waren wir durch Trastevere spaziert, hatten viel geredet, manchmal ganz leise, hatten laut gelacht, italienische und deutsche Wörter vermischt, neue Worte geschaffen und oft geschwiegen. Wie eine echte Italienerin hatte ich mich gefühlt. Mit Jaron an meiner Seite, mit dem Menschen, dem ich am meisten vertraute, und in dieser Stadt, in der jeder Pflasterstein, jede Straßenecke und jedes noch so winzige Geschäft vor Schönheit strotzte, hatte die Zeit stillgestanden. Ich rekonstruierte jedes Detail dieser drei Tage in Rom, versuchte, mich an jedes Gespräch zu erinnern. Die Fotos, die Jaron mit seiner alten Kamera geschossen und danach hatte entwickeln lassen, holte ich beinahe täglich aus der obersten Kommodenschublade und sah sie durch, eines nach dem anderen, wie ein Mantra, eine Sucht.
Für einen kurzen Augenblick fühlte ich mich ihm dann so nah, dass ich dafür die Absurdität der routinierten Situation in Kauf nahm. Schlagartig überkam mich ein Gedanke. Wie nah ich meinem Bruder im Ferienhaus, in unserem alten gemeinsamen Zimmer, in dem Garten und an dem Strandabschnitt sein könnte. Wie viele Erinnerungen hochkommen müssten, wenn ich dort wäre. Ich blickte zu meiner Mutter, die, ebenso wie ich selbst, in Gedanken weit weg zu sein schien.
»Mama, ich kann doch ins Cux fahren. Und den Garten machen, weißt du. Und so generell, damit mal wieder jemand da ist.« Mariam zog die Stirn zusammen, sodass sich die beiden parallelen Falten zwischen ihren Augenbrauen tief in die Haut gruben. Wie versteinert hielt sie einige Sekunden inne. »Wenn du meinst, dass du das kannst«, sagte sie schließlich. Es klang eher wie eine Frage, deren Antwort sie nicht interessierte. Ich nickte, »Ja, ich glaube schon. Vielleicht tut es euch auch mal gut, für euch zu sein.«
Und mir, allein, allein und mit Jaron zu sein, dachte ich. Wie zur Bestätigung drang ein genervtes Stöhnen von Jakob aus der Gartenecke. »Dann kann ich mich wenigstens ein bisschen nützlich machen, wenn ich schon nichts anderes auf die Reihe bekomme«, fügte ich hinzu. Meine Eltern stellten nicht infrage, dass ich an der Uni pausierte, thematisierten es gar nicht, es war schlichtweg logisch, dass ich momentan nicht hin ging. »Lass uns das später mit Papa besprechen, ok?«, sagte Mariam. Ich nickte. Meine Entscheidung hatte ich längst getroffen. Ein Adrenalinstoß durchfuhr mich. So müssen sich die Junkies in der U-Bahn-Unterführung fühlen, kurz bevor sie sich den rettenden Schuss setzen, dachte ich.
***
Die Haustür knarrte bedrohlich, als sich der Schlüssel, mit viel Rütteln und meinen stummen Stoßgebeten, endlich im Schloss herumdrehen ließ. Obwohl ich von der stehenden Luft erschlagen wurde, war der Blick in den Raum wunderschön. Der antike Holzschrank wurde von der Sonne, die durch die staubigen Fenster eindrang, in sanftes Licht getaucht. Die Staubkörner tanzten durch den Raum. Mir wurde augenblicklich warm. Ich hatte fest damit gerechnet, unmittelbar von der Vergangenheit und den Bildern in meinem Kopf eingeholt zu werden, wenn ich das Haus betreten würde. Aber so war es nicht. Es war viel simpler, einfach ein schöner Anblick.
Ich ließ die Reisetasche von der Schulter auf den Boden gleiten und riss die vier Fenster auf. Der Durchzug ließ die Staubkörner vibrieren. Noch bevor ich auspackte, stellte ich die Kaffeemaschine an, deren lautes Brummen den Raum auf eine angenehme und beruhigende Art und Weise vollständig ausfüllte. Die Siebträgermaschine für das Ferienhaus hatten Jaron und ich unserer Mutter zu Weihnachten geschenkt. Ich war auf die Idee gekommen, eine richtig gute Idee, wie ich fand: die perfekte Mischung aus Nutz- und Luxusgerät, vorausgesetzt, man schätzte Kaffee und seine Zubereitung. Stunden hatten wir gemeinsam vor dem Laptop verbracht auf der Suche nach dem neuesten Modell, der Marke mit den besten Bewertungen und dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Letztendlich hatten wir uns für die schönste entschieden und unsere Wahl nie bereut.
Weil vielleicht am Ende doch immer das Aussehen den Ausschlag gab, trotz der anfänglichen Beteuerung, nur die inneren Werte zählten. Aber wer hatte festgelegt, dass Oberflächlichkeit negativ behaftet sein musste? Man blickte noch nicht dahinter, ging noch nicht in die Tiefe, bewertete nur nach dem ersten Eindruck. Wieso sollte diese erste Bewertung, die intuitive, nicht wichtig sein? Nicht mattes Schwarz, sondern glänzendes Silber, das war meine Intuition bei der Kaffeemaschine und eine verdammt gute Entscheidung gewesen. Mutter hatte sie dann nach Cux gebracht. Ich strich über das Edelstahl, den edlen Stahl, und betrachte kurz den Staub in meiner Handfläche, bevor ich ihn an der Jeans abstrich und die Maschine anstellte. Das duftende Pulver ins Sieb füllte, mit dem Stempel andrückte und einspannte. Jeder Handgriff geschah wie von selbst.
Mit der dampfenden Kaffeetasse in der Hand ließ ich mich auf die Holzbank neben der Haustüre sinken und lehnte den Kopf gegen die Wand. Das Gesicht der wärmenden Sonne entgegengestreckt. Es hatte sich wie Fliehen angefühlt, als ich beschlossen hatte, hierher zu fahren. Fliehen vor der erdrückenden Traurigkeit meiner Eltern, der Verantwortung, dem Druck, den ich dauerhaft in meiner Brust spürte. Vor allem aber war es eine Flucht vor einem sich einstellenden Alltag. So sehr ich mich nach Normalität, nach Routine sehnte, so sehr sträubte ich mich dagegen. Ich konnte es nicht zulassen. Weil es sich, egal wie ich gedanklich und bewusst dagegen steuerte, nach Verrat anfühlte.
Die Lust auf eine Zigarette überkam mich augenblicklich, als ich den ersten Schluck des heißen Kaffees hinunterschluckte. Ich gab ihm nach, stellte die Tasse neben mich, ging ins Haus und kramte zuerst die Schachtel aus dem Beutel, dann ein überdimensionales Feuerzeug aus der Küchenschublade. Mit beidem und einem Kissen vom Sofa ließ ich mich wieder auf die Bank fallen. Bei dem Gedanken, dass Mariam mit Sicherheit nicht damit einverstanden gewesen wäre, das gute Kissen auf die schmutzige Bank zu legen, musste ich schmunzeln. Viel mehr aber noch darüber, dass ich selbst kurz innehielt, überlegte und mich dann bewusst dafür entschied, nicht im Sinne meiner Mutter zu handeln.
Seit Jarons Tod hatte ich angefangen, regelmäßig zu rauchen, in dem Wissen, er hätte es gehasst und mich konsequent damit konfrontiert und dafür verurteilt. Vielleicht aber auch gerade deswegen. Ich stellte mir vor, wie er neben mir saß, kopfschüttelnd und naserümpfend und mir bis ins kleinste Detail ausmalte, wie schlecht ich meinen Körper behandelte. Ich würde alles abnicken und ihm jedes Mal auch eine anbieten. Dass ich tatsächlich kurz nickte, ließ mich ruckartig in der Realität ankommen. Die ganze Situation war absurd. Ich, in der Sonne, allein, hier.
Ich kannte das Haus nur voller Leben, voller Familie. Als würde mein Vater jeden Moment aus der Küche rufen, dass serviert werden könne. Oder meine Mutter mit der Gartenschere in der Hand um die Ecke kommen und sich über den viel zu alten und langsamen Rasenmäher beschweren. Obwohl ich zum ersten Mal in meinem Leben allein hier war, fühlte es sich richtig an, richtig und unerwartet gut. Bis die Sonne hinter der großen Tanne und schließlich ganz verschwand, saß ich im Schneidersitz auf der Bank. Die wohlbekannte Angst vor der Nacht überkam mich erst beim Hinaufsteigen der Treppe und begleitete mich bis ins Zimmer. Augen
Rasch zog ich die Hose und den BH unter dem Shirt aus und tapste ins Bad, um die Zähne zu putzen. Der schwarzweiß gemusterte Fliesenboden war eiskalt. Während ich fröstelnd und müde auf dem Klo saß, starrte ich meine Füße an. Wog ab, ob ich es riskieren konnte, heute keine Schlafmittel zu nehmen. Es wäre das erste Mal seit seinem Todestag. Die Nägel auf meinen dicken Zehen waren zur Hälfte orange. Ich hatte sie für die Verlobungsparty eines befreundeten Pärchens extra passend zu dem neu gekauften Kleid lackiert. Wie der Überrest eines total normalen Sommers glitzerte mir die Farbe provokant entgegen. Augen
Foto: Annie Spratt/Unsplash
Testen Sie uns und schreiben Sie ebenfalls Ihre Geschichte:
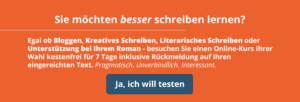


Lena
wunderbar erzählt, ich möchte weiterlesen!